top of page

Kamel Berkouk (1967)
Frankreich
Öl auf Leinwand
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Kamel Berkouk (1967)
Frankreich
Öl auf Leinwand
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Kamel Berkouk (1967)
Frankreich
Öl auf Leinwand
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.
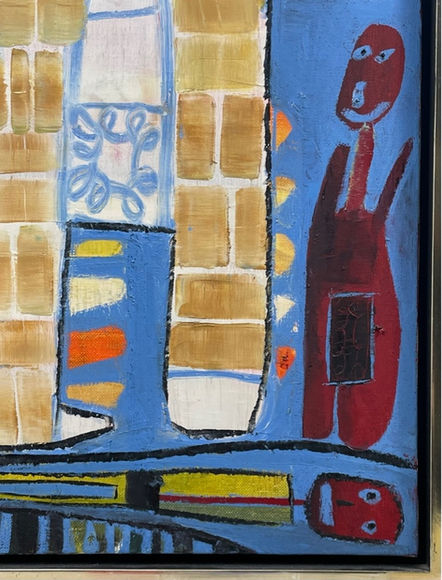
Kamel Berkouk (1967)
Frankreich
Öl auf Leinwand
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.
Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.
Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.
Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.
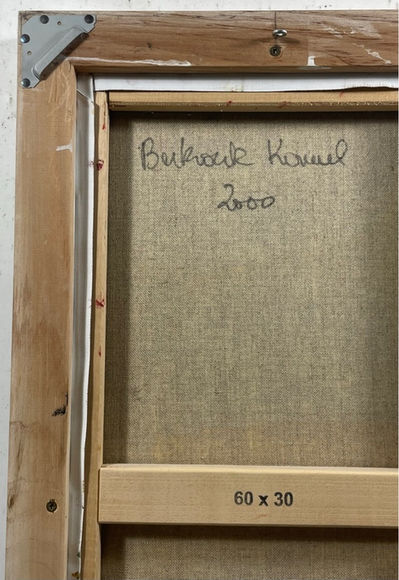
Kamel Berkouk (1967)
Frankreich
Öl auf Leinwand
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—
Verso signiert und datiert, Jahr 2000
Bildmass: 60,0 x 30,0 mm
Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm
Preis: CHF 640.—

JUNGBLUT, JOHANN
(Saarburg 1860–1912 Düsseldorf)
Norddeutsche Küstenlandschaft.
Öl auf Leinwand.
Unten rechts signiert: J. Jungblut.
Provenienz:
- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.
- Schweizer Privatsammlung
Mass: 64,5 x 98 cm
Preis: CHF 850.-
Norddeutsche Küstenlandschaft.
Öl auf Leinwand.
Unten rechts signiert: J. Jungblut.
Provenienz:
- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.
- Schweizer Privatsammlung
Mass: 64,5 x 98 cm
Preis: CHF 850.-

JUNGBLUT, JOHANN
(Saarburg 1860–1912 Düsseldorf)
Norddeutsche Küstenlandschaft.
Öl auf Leinwand.
Unten rechts signiert: J. Jungblut.
Provenienz:
- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.
- Schweizer Privatsammlung
Mass: 64,5 x 98 cm
Preis: CHF 850.-
Norddeutsche Küstenlandschaft.
Öl auf Leinwand.
Unten rechts signiert: J. Jungblut.
Provenienz:
- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.
- Schweizer Privatsammlung
Mass: 64,5 x 98 cm
Preis: CHF 850.-

JUNGBLUT, JOHANN
(Saarburg 1860–1912 Düsseldorf)
Norddeutsche Küstenlandschaft.
Öl auf Leinwand.
Unten rechts signiert: J. Jungblut.
Provenienz:
- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.
- Schweizer Privatsammlung
Mass: 64,5 x 98 cm
Preis: CHF 850.-
Norddeutsche Küstenlandschaft.
Öl auf Leinwand.
Unten rechts signiert: J. Jungblut.
Provenienz:
- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.
- Schweizer Privatsammlung
Mass: 64,5 x 98 cm
Preis: CHF 850.-
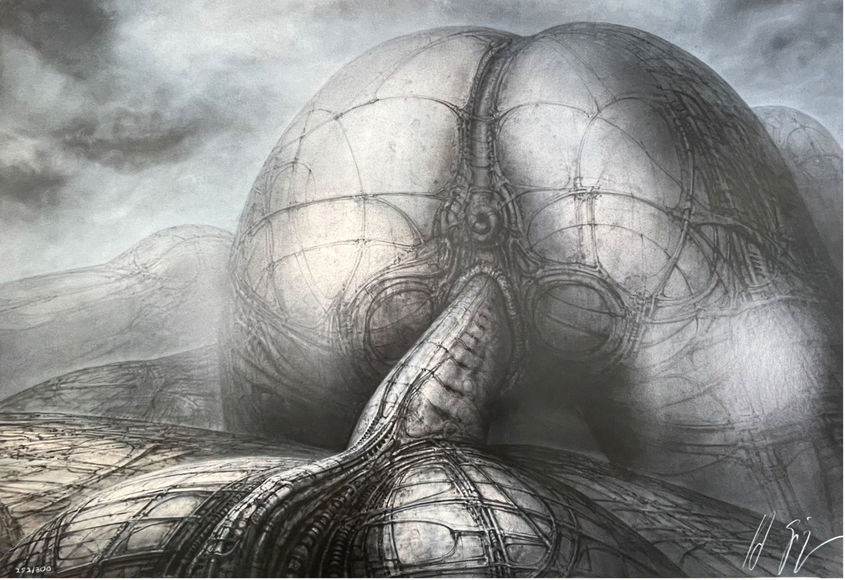
H. R. Giger
Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)
Unten rechts Signiert
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.
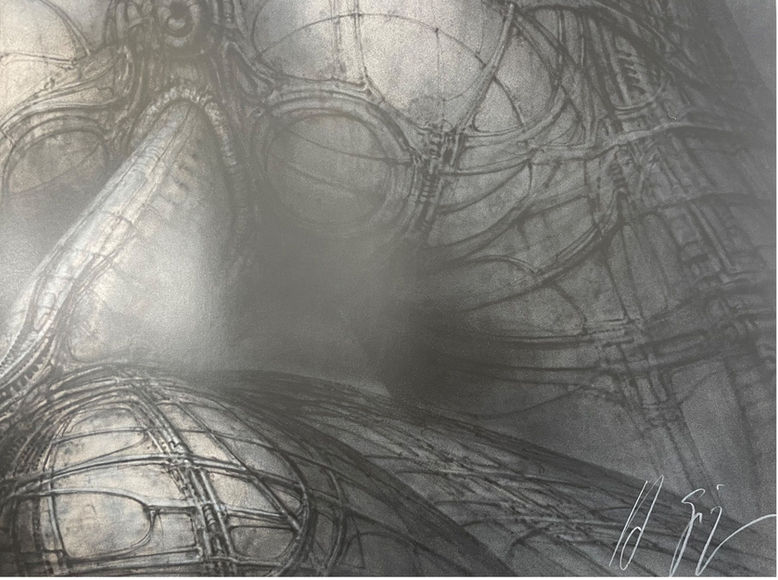
H. R. Giger
Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)
Unten rechts Signiert
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

H. R. Giger
Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)
Unten rechts Signiert
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

H. R. Giger
Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)
Unten rechts Signiert
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.
Unten links Nummeriert
Technik : Serigraphie 282 / 300
Blattmass : 100x70cm
war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.
Preis: CHF 1'360.-
Fleisch wurde Technik wurde Fleisch
Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.
Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.
Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.
Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung
Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.
Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

Gustave-François-Jules Barraud
04.05.1883 Genève - † 22.09.1964 Genève
Titel: "La belle au bois dormant"
Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet
Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.
Zustand: Gut
Preis: CHF 1'800.-
Biographie:
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)
Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.
Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.
A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).
(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)
Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet
Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.
Zustand: Gut
Preis: CHF 1'800.-
Biographie:
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)
Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.
Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.
A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).
(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)

Gustave-François-Jules Barraud
04.05.1883 Genève - † 22.09.1964 Genève
Titel: "La belle au bois dormant"
Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet
Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.
Zustand: Gut
Preis: CHF 1'800.-
Biographie:
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)
Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.
Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.
A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).
(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)
Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet
Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.
Zustand: Gut
Preis: CHF 1'800.-
Biographie:
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)
Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.
Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.
A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).
(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)
Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)

Gustave-François-Jules Barraud
04.05.1883 Genève - † 22.09.1964 Genève

Rudolf Mumprecht
1918 Basel, † 2019 Bern)
Titel: Geisterbahn - 1985
Technik: Mischtechnik auf Papier
Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985
Zustand: Gut
Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: Sammlung Peter Schuler
Biographie:
Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.
Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.
Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.
Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.
Technik: Mischtechnik auf Papier
Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985
Zustand: Gut
Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: Sammlung Peter Schuler
Biographie:
Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.
Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.
Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.
Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Rudolf Mumprecht
1918 Basel, † 2019 Bern)
Titel: Geisterbahn - 1985
Technik: Mischtechnik auf Papier
Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985
Zustand: Gut
Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: Sammlung Peter Schuler
Biographie:
Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.
Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.
Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.
Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.
Technik: Mischtechnik auf Papier
Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985
Zustand: Gut
Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: Sammlung Peter Schuler
Biographie:
Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.
Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.
Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.
Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Rudolf Mumprecht
1918 Basel, † 2019 Bern)

Rodolphe-Théophile Bosshard
1889 Morges, † 1960 Chardonne
Titel: "Fleurs" - 1929
Technik: Aquarell auf Papier
Grösse: Darstellung 25 x 42 cm
Rahmen 45 x 61 cm
Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).
Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette
Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.
Zustand: Gut
Preis: Sammlung Peter Schuler
Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.
Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.
Titel: "Fleurs" - 1929
Technik: Aquarell auf Papier
Grösse: Darstellung 25 x 42 cm
Rahmen 45 x 61 cm
Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).
Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette
Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.
Zustand: Gut
Preis: Sammlung Peter Schuler
Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.
Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.
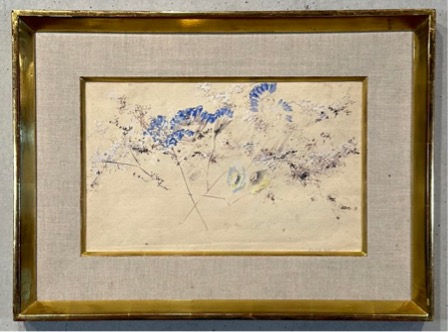
Rodolphe-Théophile Bosshard
1889 Morges, † 1960 Chardonne
Titel: "Fleurs" - 1929
Technik: Aquarell auf Papier
Grösse: Darstellung 25 x 42 cm
Rahmen 45 x 61 cm
Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).
Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette
Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.
Zustand: Gut
Preis: Sammlung Peter Schuler
Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.
Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.
Titel: "Fleurs" - 1929
Technik: Aquarell auf Papier
Grösse: Darstellung 25 x 42 cm
Rahmen 45 x 61 cm
Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).
Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette
Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.
Zustand: Gut
Preis: Sammlung Peter Schuler
Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.
Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Rodolphe-Théophile Bosshard
1889 Morges, † 1960 Chardonne
Titel: "Fleurs" - 1929
Technik: Aquarell auf Papier
Grösse: Darstellung 25 x 42 cm
Rahmen 45 x 61 cm
Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).
Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette
Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.
Zustand: Gut
Preis: Sammlung Peter Schuler
Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.
Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.
Titel: "Fleurs" - 1929
Technik: Aquarell auf Papier
Grösse: Darstellung 25 x 42 cm
Rahmen 45 x 61 cm
Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).
Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette
Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.
Zustand: Gut
Preis: Sammlung Peter Schuler
Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.
Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)
Titel: Ohne Titel - 1969
Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen
Grösse: 131 x 164 cm
Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 3'200.-
Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen
Grösse: 131 x 164 cm
Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 3'200.-
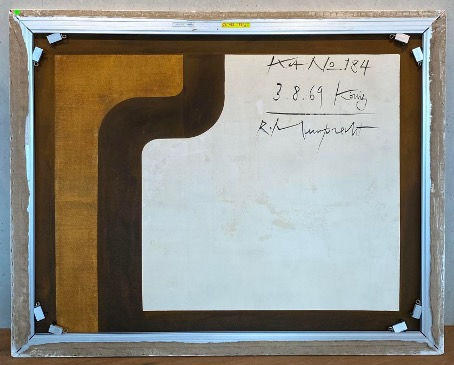
Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)
Titel: Ohne Titel - 1969
Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen
Grösse: 131 x 164 cm
Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 3'200.-
Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen
Grösse: 131 x 164 cm
Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.
Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 3'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)
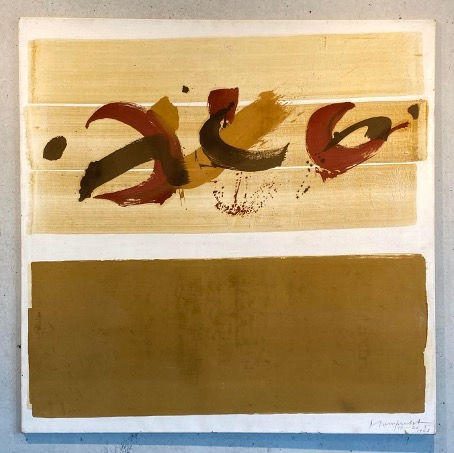
Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)
Titel: Ohne Titel - 1968
Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 100 x 100 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 1'200.-
Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 100 x 100 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 1'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)
Titel: Ohne Titel - 1968
Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 100 x 100 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 1'200.-
Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen
Grösse: 100 x 100 cm
Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert
Zustand: Gut - aufhängefertig!
Rahmen: Nicht gerahmt.
Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht
Preis: CHF 1'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)
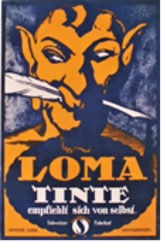
LOMA TINTE MEPHISTO 1914
Original Plakat Lithographie von 1914
Zustand A
Masse: 60 x 90 cm
Preis: CHF 160.- (ohne Rahmen)
Zustand A
Masse: 60 x 90 cm
Preis: CHF 160.- (ohne Rahmen)

Hermann Rüdisühli
vollst. Name Traugott Hermann Rüdisühli;
10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München
Titel: Herbstliche Teichlandschaft
Öl / Lwd
Masse: 35 x 45,5 cm
Kleine Pigmentflecken
Preis: CHF 380.-
Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.
Biografie:
Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.
Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.
Rezeption
Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.
Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.
10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München
Titel: Herbstliche Teichlandschaft
Öl / Lwd
Masse: 35 x 45,5 cm
Kleine Pigmentflecken
Preis: CHF 380.-
Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.
Biografie:
Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.
Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.
Rezeption
Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.
Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.

Hermann Rüdisühli
vollst. Name Traugott Hermann Rüdisühli;
10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München
Titel: Herbstliche Teichlandschaft
Öl / Lwd
Masse: 35 x 45,5 cm
Kleine Pigmentflecken
Preis: CHF 380.-
Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.
Biografie:
Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.
Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.
Rezeption
Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.
Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.
10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München
Titel: Herbstliche Teichlandschaft
Öl / Lwd
Masse: 35 x 45,5 cm
Kleine Pigmentflecken
Preis: CHF 380.-
Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.
Biografie:
Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.
Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.
Rezeption
Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.
Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.

Hermann Rüdisühli

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz
Titel: Herbstlicher Waldweg
1930
Signiert und datiert
Öl / Lwd
Masse: 69.5 x 55 cm
Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen
Impressionistischer Manier gemalt
Preis: CHF 1'200.-
Biografie:
JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.
1930
Signiert und datiert
Öl / Lwd
Masse: 69.5 x 55 cm
Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen
Impressionistischer Manier gemalt
Preis: CHF 1'200.-
Biografie:
JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz
Titel: Herbstlicher Waldweg
1930
Signiert und datiert
Öl / Lwd
Masse: 69.5 x 55 cm
Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen
Impressionistischer Manier gemalt
Preis: CHF 1'200.-
Biografie:
JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.
1930
Signiert und datiert
Öl / Lwd
Masse: 69.5 x 55 cm
Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen
Impressionistischer Manier gemalt
Preis: CHF 1'200.-
Biografie:
JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.
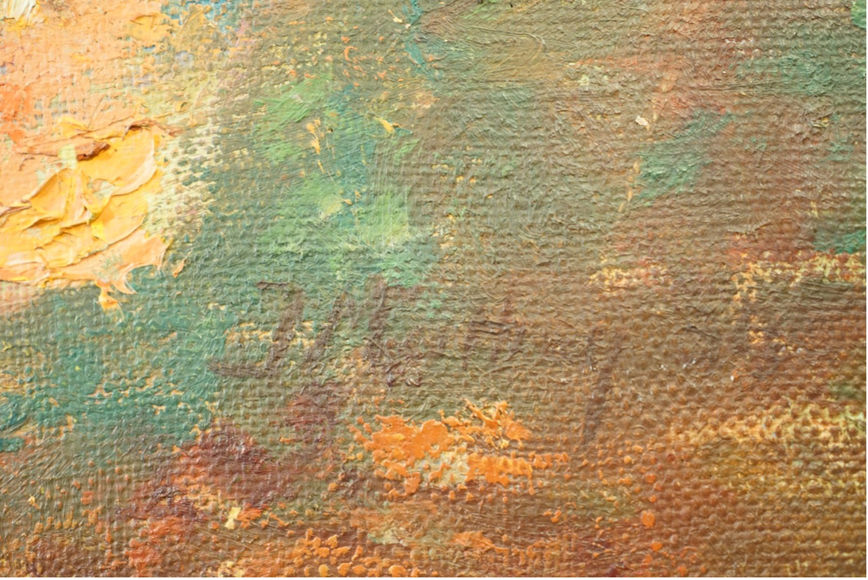
Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz
Titel: Herbstlicher Waldweg
1930
Signiert und datiert
Öl / Lwd
Masse: 69.5 x 55 cm
Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen
Impressionistischer Manier gemalt
Preis: CHF 1'200.-
Biografie:
JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.
1930
Signiert und datiert
Öl / Lwd
Masse: 69.5 x 55 cm
Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen
Impressionistischer Manier gemalt
Preis: CHF 1'200.-
Biografie:
JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz

Caroline Burnett
American | 1877 – 1950
Titel: Pariser Strassenszene
Öl auf Leinwand
Masse:
Bild; 60x 50 cm
Rahmen; 75,5 x 66 cm
Preis: CHF 480.-
Biographie:
Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.
Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.
Öl auf Leinwand
Masse:
Bild; 60x 50 cm
Rahmen; 75,5 x 66 cm
Preis: CHF 480.-
Biographie:
Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.
Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.

Caroline Burnett
American | 1877 – 1950
Titel: Pariser Strassenszene
Öl auf Leinwand
Masse:
Bild; 60x 50 cm
Rahmen; 75,5 x 66 cm
Preis: CHF 480.-
Biographie:
Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.
Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.
Öl auf Leinwand
Masse:
Bild; 60x 50 cm
Rahmen; 75,5 x 66 cm
Preis: CHF 480.-
Biographie:
Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.
Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.

Caroline Burnett
American | 1877 – 1950
Titel: Pariser Strassenszene
Öl auf Leinwand
Masse:
Bild; 60x 50 cm
Rahmen; 75,5 x 66 cm
Preis: CHF 480.-
Biographie:
Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.
Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.
Öl auf Leinwand
Masse:
Bild; 60x 50 cm
Rahmen; 75,5 x 66 cm
Preis: CHF 480.-
Biographie:
Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.
Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.

Caroline Burnett
American | 1877 – 1950
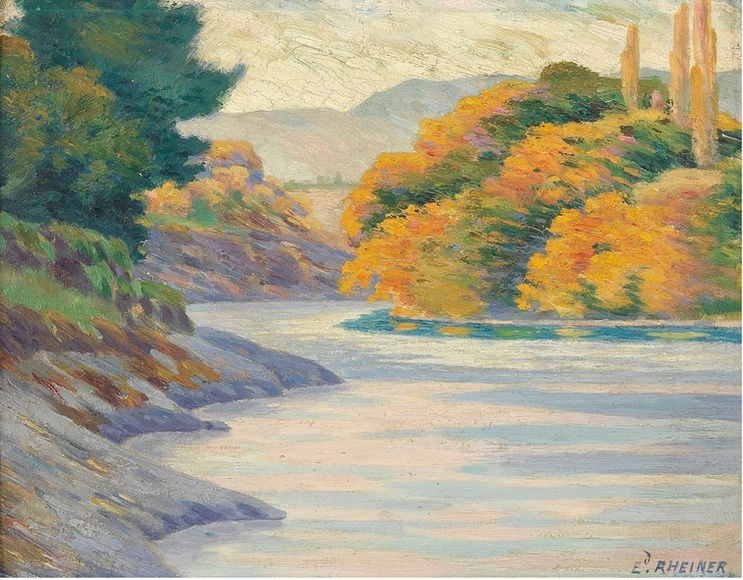
Edouard Rheiner (1865-1921)
Titel : Rhoneufer im Herbst
Öl auf Karton
Signiert: unten rechts
Masse: 27 x 35 cm
Originalrahmen
Description:
Bord du Rhône en automne, huile sur carton, signée,
Mesure : 27 x 35 cm
Preis: CHF 720.-
BIOGRAPHIE:
Ausbildung zum Dekorationsmaler, dann zum Maler bei seinem Bruder Louis.
Signiert: unten rechts
Masse: 27 x 35 cm
Originalrahmen
Description:
Bord du Rhône en automne, huile sur carton, signée,
Mesure : 27 x 35 cm
Preis: CHF 720.-
BIOGRAPHIE:
Ausbildung zum Dekorationsmaler, dann zum Maler bei seinem Bruder Louis.

Edouard Rheiner (1865-1921)
Titel : Rhoneufer im Herbst
Öl auf Karton
Signiert: unten rechts
Masse: 27 x 35 cm
Originalrahmen
Description:
Bord du Rhône en automne, huile sur carton, signée,
Mesure : 27 x 35 cm
Preis: CHF 720.-
BIOGRAPHIE:
Ausbildung zum Dekorationsmaler, dann zum Maler bei seinem Bruder Louis.
Signiert: unten rechts
Masse: 27 x 35 cm
Originalrahmen
Description:
Bord du Rhône en automne, huile sur carton, signée,
Mesure : 27 x 35 cm
Preis: CHF 720.-
BIOGRAPHIE:
Ausbildung zum Dekorationsmaler, dann zum Maler bei seinem Bruder Louis.
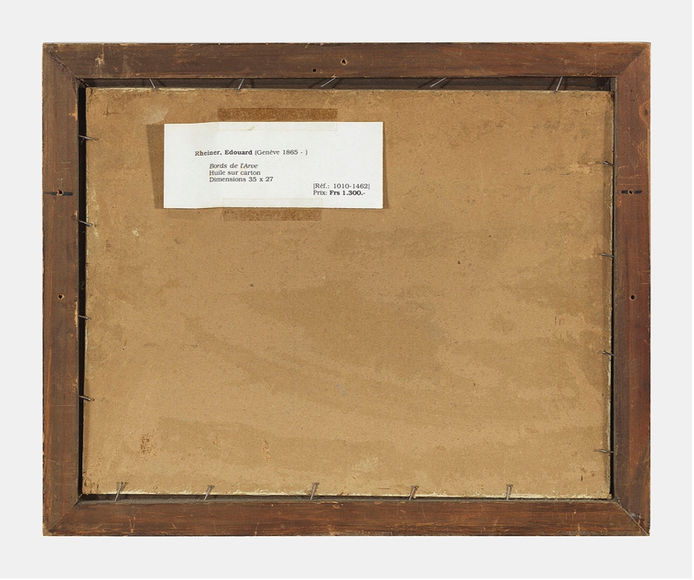
Edouard Rheiner (1865-1921)
Titel : Rhoneufer im Herbst

Schang Hutter
Jean Albert «Schang» Hutter
11. August 1934 in Solothurn; † 14. Juni 2021
Schweizer Bildhauer.
Zeichnung auf Packpapier
Jahr; 1987
Signiert u. datiert; unten links
Masse: 57 x 37 cm
Originalrahmen
Preis: Auf Anfrage
Biografie:
Von 1950 bis 1954 machte Hutter eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb und besuchte daneben die Kunstgewerbeschule in Bern. 1954 zog er nach München und studierte dort bis 1961 u. a. bei Charles Crodel und Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste. Die in München angetroffenen Kriegsversehrten liessen ihn nicht mehr los. 1961 kehrte er in den Kanton Solothurn zurück, wo er hauptsächlich in Küttigkofen lebte und wo er seine Münchner Eindrücke weiter verarbeitete.[2] 1969/1970 folgte ein Aufenthalt in Warschau. Ab 1978 war er der erste Präsident der gastronomischen Genossenschaft Baseltor. 1971 trat in die SP ein und kandidierte 1981 im Kanton Solothurn für den Ständerat.
Von 1982 bis 1985 lebte er in Hamburg und von 1985 bis 1987 in Berlin. Darauf zog er ins solothurnische Hessigkofen. Zusammen mit den Berner Architekten Ueli Schweizer und Walter Hunziker und dem Berner Landschaftsarchitekten Franz Vogel gestaltete er eine 1994 abgeschlossene Erweiterung des Friedhofs Bümpliz.
Am 28. Februar 1998 stellte Hutter im Rahmen eines Skulpturenweges zum 200. Jubiläum der Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah auf. Weil er dies drei Meter neben dem ursprünglich vereinbarten Standort tat, wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 4. März 1998 von der Freiheits-Partei der Schweiz abtransportiert und vor die Werkstatt des Künstlers gebracht, worauf eine heftige öffentliche Debatte begann. Die Skulptur wurde danach in Zürich, Basel, Aarau, Solothurn und Glarus ausgestellt und steht heute in Langenthal.
Ab 1999 lebte Hutter in Genua, mit sporadischem Wohnsitz im solothurnischen Derendingen. Permanent ausgestellt sind seine Werke in einer alten Fabrikhalle in Huttwil und auf dem Gelände eines Fabrikareals in Langenthal. 2005 erschienen in der Kunstrevue Trou[3] bis dahin unveröffentlichte Arbeiten von Schang Hutter sowie sein Text «Shoah II» in Deutsch und in französischer Übersetzung.
Anlässlich von Hutters 80. Geburtstag organisierte und kuratierte Ute Winselmann Adatte im Tramdepot Burgernziel in Bern vom 10. August bis 10. November 2014 eine grosse Jubiläumsausstellung.[4] Auf 5000 m² wurden 800 charakteristische Werke aus den vergangenen 60 Jahren gezeigt. Gleichzeitig erschien eine umfangreiche Monographie zu Leben und Werk, Schang Hutter: «Der Verletzlichkeit Raum geben» von Hanspeter Gschwend.
Mitte Juni 2021 starb Schang Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Schauspielerin Sophie Hutter ist seine Enkelin.
Schweizer Bildhauer.
Zeichnung auf Packpapier
Jahr; 1987
Signiert u. datiert; unten links
Masse: 57 x 37 cm
Originalrahmen
Preis: Auf Anfrage
Biografie:
Von 1950 bis 1954 machte Hutter eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb und besuchte daneben die Kunstgewerbeschule in Bern. 1954 zog er nach München und studierte dort bis 1961 u. a. bei Charles Crodel und Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste. Die in München angetroffenen Kriegsversehrten liessen ihn nicht mehr los. 1961 kehrte er in den Kanton Solothurn zurück, wo er hauptsächlich in Küttigkofen lebte und wo er seine Münchner Eindrücke weiter verarbeitete.[2] 1969/1970 folgte ein Aufenthalt in Warschau. Ab 1978 war er der erste Präsident der gastronomischen Genossenschaft Baseltor. 1971 trat in die SP ein und kandidierte 1981 im Kanton Solothurn für den Ständerat.
Von 1982 bis 1985 lebte er in Hamburg und von 1985 bis 1987 in Berlin. Darauf zog er ins solothurnische Hessigkofen. Zusammen mit den Berner Architekten Ueli Schweizer und Walter Hunziker und dem Berner Landschaftsarchitekten Franz Vogel gestaltete er eine 1994 abgeschlossene Erweiterung des Friedhofs Bümpliz.
Am 28. Februar 1998 stellte Hutter im Rahmen eines Skulpturenweges zum 200. Jubiläum der Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah auf. Weil er dies drei Meter neben dem ursprünglich vereinbarten Standort tat, wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 4. März 1998 von der Freiheits-Partei der Schweiz abtransportiert und vor die Werkstatt des Künstlers gebracht, worauf eine heftige öffentliche Debatte begann. Die Skulptur wurde danach in Zürich, Basel, Aarau, Solothurn und Glarus ausgestellt und steht heute in Langenthal.
Ab 1999 lebte Hutter in Genua, mit sporadischem Wohnsitz im solothurnischen Derendingen. Permanent ausgestellt sind seine Werke in einer alten Fabrikhalle in Huttwil und auf dem Gelände eines Fabrikareals in Langenthal. 2005 erschienen in der Kunstrevue Trou[3] bis dahin unveröffentlichte Arbeiten von Schang Hutter sowie sein Text «Shoah II» in Deutsch und in französischer Übersetzung.
Anlässlich von Hutters 80. Geburtstag organisierte und kuratierte Ute Winselmann Adatte im Tramdepot Burgernziel in Bern vom 10. August bis 10. November 2014 eine grosse Jubiläumsausstellung.[4] Auf 5000 m² wurden 800 charakteristische Werke aus den vergangenen 60 Jahren gezeigt. Gleichzeitig erschien eine umfangreiche Monographie zu Leben und Werk, Schang Hutter: «Der Verletzlichkeit Raum geben» von Hanspeter Gschwend.
Mitte Juni 2021 starb Schang Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Schauspielerin Sophie Hutter ist seine Enkelin.

Schang Hutter
Jean Albert «Schang» Hutter
11. August 1934 in Solothurn; † 14. Juni 2021
Schweizer Bildhauer.
Zeichnung auf Packpapier
Jahr; 1987
Signiert u. datiert; unten links
Masse: 57 x 37 cm
Originalrahmen
Preis: Auf Anfrage
Biografie:
Von 1950 bis 1954 machte Hutter eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb und besuchte daneben die Kunstgewerbeschule in Bern. 1954 zog er nach München und studierte dort bis 1961 u. a. bei Charles Crodel und Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste. Die in München angetroffenen Kriegsversehrten liessen ihn nicht mehr los. 1961 kehrte er in den Kanton Solothurn zurück, wo er hauptsächlich in Küttigkofen lebte und wo er seine Münchner Eindrücke weiter verarbeitete.[2] 1969/1970 folgte ein Aufenthalt in Warschau. Ab 1978 war er der erste Präsident der gastronomischen Genossenschaft Baseltor. 1971 trat in die SP ein und kandidierte 1981 im Kanton Solothurn für den Ständerat.
Von 1982 bis 1985 lebte er in Hamburg und von 1985 bis 1987 in Berlin. Darauf zog er ins solothurnische Hessigkofen. Zusammen mit den Berner Architekten Ueli Schweizer und Walter Hunziker und dem Berner Landschaftsarchitekten Franz Vogel gestaltete er eine 1994 abgeschlossene Erweiterung des Friedhofs Bümpliz.
Am 28. Februar 1998 stellte Hutter im Rahmen eines Skulpturenweges zum 200. Jubiläum der Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah auf. Weil er dies drei Meter neben dem ursprünglich vereinbarten Standort tat, wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 4. März 1998 von der Freiheits-Partei der Schweiz abtransportiert und vor die Werkstatt des Künstlers gebracht, worauf eine heftige öffentliche Debatte begann. Die Skulptur wurde danach in Zürich, Basel, Aarau, Solothurn und Glarus ausgestellt und steht heute in Langenthal.
Ab 1999 lebte Hutter in Genua, mit sporadischem Wohnsitz im solothurnischen Derendingen. Permanent ausgestellt sind seine Werke in einer alten Fabrikhalle in Huttwil und auf dem Gelände eines Fabrikareals in Langenthal. 2005 erschienen in der Kunstrevue Trou[3] bis dahin unveröffentlichte Arbeiten von Schang Hutter sowie sein Text «Shoah II» in Deutsch und in französischer Übersetzung.
Anlässlich von Hutters 80. Geburtstag organisierte und kuratierte Ute Winselmann Adatte im Tramdepot Burgernziel in Bern vom 10. August bis 10. November 2014 eine grosse Jubiläumsausstellung.[4] Auf 5000 m² wurden 800 charakteristische Werke aus den vergangenen 60 Jahren gezeigt. Gleichzeitig erschien eine umfangreiche Monographie zu Leben und Werk, Schang Hutter: «Der Verletzlichkeit Raum geben» von Hanspeter Gschwend.
Mitte Juni 2021 starb Schang Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Schauspielerin Sophie Hutter ist seine Enkelin.
Schweizer Bildhauer.
Zeichnung auf Packpapier
Jahr; 1987
Signiert u. datiert; unten links
Masse: 57 x 37 cm
Originalrahmen
Preis: Auf Anfrage
Biografie:
Von 1950 bis 1954 machte Hutter eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb und besuchte daneben die Kunstgewerbeschule in Bern. 1954 zog er nach München und studierte dort bis 1961 u. a. bei Charles Crodel und Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste. Die in München angetroffenen Kriegsversehrten liessen ihn nicht mehr los. 1961 kehrte er in den Kanton Solothurn zurück, wo er hauptsächlich in Küttigkofen lebte und wo er seine Münchner Eindrücke weiter verarbeitete.[2] 1969/1970 folgte ein Aufenthalt in Warschau. Ab 1978 war er der erste Präsident der gastronomischen Genossenschaft Baseltor. 1971 trat in die SP ein und kandidierte 1981 im Kanton Solothurn für den Ständerat.
Von 1982 bis 1985 lebte er in Hamburg und von 1985 bis 1987 in Berlin. Darauf zog er ins solothurnische Hessigkofen. Zusammen mit den Berner Architekten Ueli Schweizer und Walter Hunziker und dem Berner Landschaftsarchitekten Franz Vogel gestaltete er eine 1994 abgeschlossene Erweiterung des Friedhofs Bümpliz.
Am 28. Februar 1998 stellte Hutter im Rahmen eines Skulpturenweges zum 200. Jubiläum der Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah auf. Weil er dies drei Meter neben dem ursprünglich vereinbarten Standort tat, wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 4. März 1998 von der Freiheits-Partei der Schweiz abtransportiert und vor die Werkstatt des Künstlers gebracht, worauf eine heftige öffentliche Debatte begann. Die Skulptur wurde danach in Zürich, Basel, Aarau, Solothurn und Glarus ausgestellt und steht heute in Langenthal.
Ab 1999 lebte Hutter in Genua, mit sporadischem Wohnsitz im solothurnischen Derendingen. Permanent ausgestellt sind seine Werke in einer alten Fabrikhalle in Huttwil und auf dem Gelände eines Fabrikareals in Langenthal. 2005 erschienen in der Kunstrevue Trou[3] bis dahin unveröffentlichte Arbeiten von Schang Hutter sowie sein Text «Shoah II» in Deutsch und in französischer Übersetzung.
Anlässlich von Hutters 80. Geburtstag organisierte und kuratierte Ute Winselmann Adatte im Tramdepot Burgernziel in Bern vom 10. August bis 10. November 2014 eine grosse Jubiläumsausstellung.[4] Auf 5000 m² wurden 800 charakteristische Werke aus den vergangenen 60 Jahren gezeigt. Gleichzeitig erschien eine umfangreiche Monographie zu Leben und Werk, Schang Hutter: «Der Verletzlichkeit Raum geben» von Hanspeter Gschwend.
Mitte Juni 2021 starb Schang Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Schauspielerin Sophie Hutter ist seine Enkelin.

Schang Hutter
Jean Albert «Schang» Hutter
11. August 1934 in Solothurn; † 14. Juni 2021
Schweizer Bildhauer.
Zeichnung auf Packpapier
Jahr; 1987
Signiert u. datiert; unten links
Masse: 57 x 37 cm
Originalrahmen
Preis: Auf Anfrage
Biografie:
Von 1950 bis 1954 machte Hutter eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb und besuchte daneben die Kunstgewerbeschule in Bern. 1954 zog er nach München und studierte dort bis 1961 u. a. bei Charles Crodel und Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste. Die in München angetroffenen Kriegsversehrten liessen ihn nicht mehr los. 1961 kehrte er in den Kanton Solothurn zurück, wo er hauptsächlich in Küttigkofen lebte und wo er seine Münchner Eindrücke weiter verarbeitete.[2] 1969/1970 folgte ein Aufenthalt in Warschau. Ab 1978 war er der erste Präsident der gastronomischen Genossenschaft Baseltor. 1971 trat in die SP ein und kandidierte 1981 im Kanton Solothurn für den Ständerat.
Von 1982 bis 1985 lebte er in Hamburg und von 1985 bis 1987 in Berlin. Darauf zog er ins solothurnische Hessigkofen. Zusammen mit den Berner Architekten Ueli Schweizer und Walter Hunziker und dem Berner Landschaftsarchitekten Franz Vogel gestaltete er eine 1994 abgeschlossene Erweiterung des Friedhofs Bümpliz.
Am 28. Februar 1998 stellte Hutter im Rahmen eines Skulpturenweges zum 200. Jubiläum der Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah auf. Weil er dies drei Meter neben dem ursprünglich vereinbarten Standort tat, wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 4. März 1998 von der Freiheits-Partei der Schweiz abtransportiert und vor die Werkstatt des Künstlers gebracht, worauf eine heftige öffentliche Debatte begann. Die Skulptur wurde danach in Zürich, Basel, Aarau, Solothurn und Glarus ausgestellt und steht heute in Langenthal.
Ab 1999 lebte Hutter in Genua, mit sporadischem Wohnsitz im solothurnischen Derendingen. Permanent ausgestellt sind seine Werke in einer alten Fabrikhalle in Huttwil und auf dem Gelände eines Fabrikareals in Langenthal. 2005 erschienen in der Kunstrevue Trou[3] bis dahin unveröffentlichte Arbeiten von Schang Hutter sowie sein Text «Shoah II» in Deutsch und in französischer Übersetzung.
Anlässlich von Hutters 80. Geburtstag organisierte und kuratierte Ute Winselmann Adatte im Tramdepot Burgernziel in Bern vom 10. August bis 10. November 2014 eine grosse Jubiläumsausstellung.[4] Auf 5000 m² wurden 800 charakteristische Werke aus den vergangenen 60 Jahren gezeigt. Gleichzeitig erschien eine umfangreiche Monographie zu Leben und Werk, Schang Hutter: «Der Verletzlichkeit Raum geben» von Hanspeter Gschwend.
Mitte Juni 2021 starb Schang Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Schauspielerin Sophie Hutter ist seine Enkelin.
Schweizer Bildhauer.
Zeichnung auf Packpapier
Jahr; 1987
Signiert u. datiert; unten links
Masse: 57 x 37 cm
Originalrahmen
Preis: Auf Anfrage
Biografie:
Von 1950 bis 1954 machte Hutter eine Lehre im elterlichen Steinmetzbetrieb und besuchte daneben die Kunstgewerbeschule in Bern. 1954 zog er nach München und studierte dort bis 1961 u. a. bei Charles Crodel und Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste. Die in München angetroffenen Kriegsversehrten liessen ihn nicht mehr los. 1961 kehrte er in den Kanton Solothurn zurück, wo er hauptsächlich in Küttigkofen lebte und wo er seine Münchner Eindrücke weiter verarbeitete.[2] 1969/1970 folgte ein Aufenthalt in Warschau. Ab 1978 war er der erste Präsident der gastronomischen Genossenschaft Baseltor. 1971 trat in die SP ein und kandidierte 1981 im Kanton Solothurn für den Ständerat.
Von 1982 bis 1985 lebte er in Hamburg und von 1985 bis 1987 in Berlin. Darauf zog er ins solothurnische Hessigkofen. Zusammen mit den Berner Architekten Ueli Schweizer und Walter Hunziker und dem Berner Landschaftsarchitekten Franz Vogel gestaltete er eine 1994 abgeschlossene Erweiterung des Friedhofs Bümpliz.
Am 28. Februar 1998 stellte Hutter im Rahmen eines Skulpturenweges zum 200. Jubiläum der Helvetik vor dem Bundeshaus in Bern seine Eisenplastik Shoah auf. Weil er dies drei Meter neben dem ursprünglich vereinbarten Standort tat, wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 4. März 1998 von der Freiheits-Partei der Schweiz abtransportiert und vor die Werkstatt des Künstlers gebracht, worauf eine heftige öffentliche Debatte begann. Die Skulptur wurde danach in Zürich, Basel, Aarau, Solothurn und Glarus ausgestellt und steht heute in Langenthal.
Ab 1999 lebte Hutter in Genua, mit sporadischem Wohnsitz im solothurnischen Derendingen. Permanent ausgestellt sind seine Werke in einer alten Fabrikhalle in Huttwil und auf dem Gelände eines Fabrikareals in Langenthal. 2005 erschienen in der Kunstrevue Trou[3] bis dahin unveröffentlichte Arbeiten von Schang Hutter sowie sein Text «Shoah II» in Deutsch und in französischer Übersetzung.
Anlässlich von Hutters 80. Geburtstag organisierte und kuratierte Ute Winselmann Adatte im Tramdepot Burgernziel in Bern vom 10. August bis 10. November 2014 eine grosse Jubiläumsausstellung.[4] Auf 5000 m² wurden 800 charakteristische Werke aus den vergangenen 60 Jahren gezeigt. Gleichzeitig erschien eine umfangreiche Monographie zu Leben und Werk, Schang Hutter: «Der Verletzlichkeit Raum geben» von Hanspeter Gschwend.
Mitte Juni 2021 starb Schang Hutter im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit in Solothurn. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Schauspielerin Sophie Hutter ist seine Enkelin.

Viktor Robert Kiener
Titel: Winterlandschaft
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia

Viktor Robert Kiener
Titel: Winterlandschaft
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia
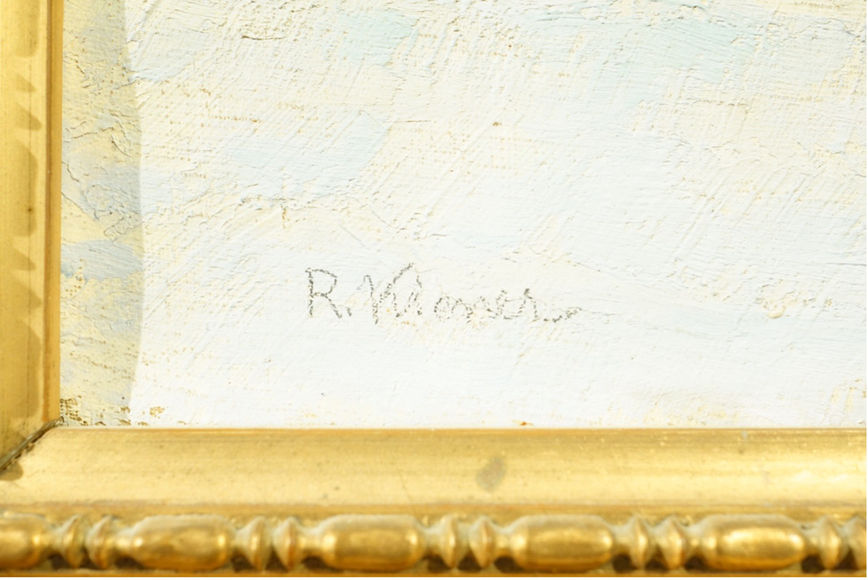
Viktor Robert Kiener
Titel: Winterlandschaft
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia

Viktor Robert Kiener
Titel: Winterlandschaft
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia
Geb. 14.Feb. 1866; Bolligen / Ges. 2. Aug. 1945; Bern
Schweizer Maler
Öl auf Leinwand / Originalrahmen
Signiert: unten links
Masse: Bild: 75 x 59 cm
Rahmen: 75 x 91 cm
Zustand: Bild und Rahmen ; gut
Preis: CHF 750.-
Über Robert Kiener:
Robert Kiener verdiente das Geld für sein Studium an der Gewerbeschule Bern mit Entwürfen zu Ofenkacheln für Berner Patrizierhäuser, für Möbel, Illustrationen in Büchern und Vorlagen für die von Konditoren in alle Welt versandten «Bärenmutzen». Während seiner Ausbildung belegte er auch Kurse bei dem Zeichen- und Mallehrer Paul Volmar an der Universität Bern.
Anschliessend konnte Kiener durch die Vermittlung von Karl Schenk sein Studium an der Académie Julian und der École Nationale des Arts Décoratifs in Paris fortsetzen. Dort freundete er sich mit Rudolf Münger und Gustav von Steiger an.
Kiener kehrte 1889 in die Schweiz zurück. 1890 erfolgte seine Wahl als Lehrer an die Zeichenschule in Saint-Imier. Hier schuf er viele seiner Jura-Landschaftsbilder. Daneben arbeitete er als anatomischer Zeichner in Zürich und Bern. Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten mit Theodor Kocher stellen ein eigenes Lebenswerk dar. Für diesen illustrierte er das Werk Operationslehre.
Kiener heiratete 1891 die Lehrerin Maria Johanna Masshard. Ab 1903 lebte er wieder in Bern und unterrichtete als Zeichenlehrer an der dortigen Mädchensekundarschule. Es folgten mehrere Studienaufenthalte in Italien.
Kiener stellte seine Werke u. a. im Kunstmuseum Bern, in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Zürich und im Aargauer Kunsthaus aus.
Text: Wikipedia

Viktor Robert Kiener

Cafes CELTICA
Original Plakat von ca. 1950
Lithographie
Masse: 30 x 40 cm
Grafik: Smell
Preis exkl. Rahmen: CHF 120 -
Preis inkl. Rahmen: CHF 200.-
Lithographie
Masse: 30 x 40 cm
Grafik: Smell
Preis exkl. Rahmen: CHF 120 -
Preis inkl. Rahmen: CHF 200.-

Hans Gartmeier (27.03.1910 - † 04.05.1986)
Signatur : unten Rechts
Technik: Öl auf Hartfaserplatte
Bild Mass : 29 x 36,5 cm
Masse mit Rahmen : 44 x 51 cm
Preis: CHF 420.-
Hans Gartmeier - künstlerisches Wirken
Hans Gartmeier, Kunstmaler aus dem Emmental. Hält in seinen Werken die Beziehung zum ursprünglichen Leben wach!
Sein künstlerisches Credo lautete: "Meine Gabe als Maler soll den Menschen zur Freude dienen. Im Sinne meiner Vorbilder. Ich versuche darzustellen, was die Natur schafft. Daneben will ich Charaktergestalten zeichnen, wie sie Jeremias Gotthelf beschrieben hat. Auf diese Art will ich ein Denkmal setzen, für die, die nach uns kommen."
Als Vorbilder haben Hans Gartmeier stets die flämischen Kleinmeister gedient. In seiner von grosser Sorgfalt gekennzeichneten Maltechnik finden wir den Ausdruck der Wirklichkeit.
Seine Kunst ist gradlinig und weicht nirgends von der realistischen Darstellung und der altmeisterlichen Gewissenhaftigkeit im Detail ab. Dabei wusste er, dass alle Kunst einem ständigen Umbruch unterworfen ist und dass nach neuen Mitteln der Darstellung gesucht werden musste.
Betrachtet man seine ruhigen, stimmungsvollen Landschaften und die friedlichen idyllischen Gegebenheiten, so überkommt einen ein inniges Behagen ob so einfacher Natürlichkeit. Man begegnet in den Bildern ziehenden Wolken im Himmelsblau, weissen Alpengipfeln hinter dunklen Wäldern und freundlichem Wiesengrün. Belebt wird die Landschaft immer wieder mit heimatlich verbundenen Menschen bei ihrer Arbeit, mit Pferden, Rindern und andern Haustieren, die der Künstler so treffend und lebendig darzustellen versteht.
Technik: Öl auf Hartfaserplatte
Bild Mass : 29 x 36,5 cm
Masse mit Rahmen : 44 x 51 cm
Preis: CHF 420.-
Hans Gartmeier - künstlerisches Wirken
Hans Gartmeier, Kunstmaler aus dem Emmental. Hält in seinen Werken die Beziehung zum ursprünglichen Leben wach!
Sein künstlerisches Credo lautete: "Meine Gabe als Maler soll den Menschen zur Freude dienen. Im Sinne meiner Vorbilder. Ich versuche darzustellen, was die Natur schafft. Daneben will ich Charaktergestalten zeichnen, wie sie Jeremias Gotthelf beschrieben hat. Auf diese Art will ich ein Denkmal setzen, für die, die nach uns kommen."
Als Vorbilder haben Hans Gartmeier stets die flämischen Kleinmeister gedient. In seiner von grosser Sorgfalt gekennzeichneten Maltechnik finden wir den Ausdruck der Wirklichkeit.
Seine Kunst ist gradlinig und weicht nirgends von der realistischen Darstellung und der altmeisterlichen Gewissenhaftigkeit im Detail ab. Dabei wusste er, dass alle Kunst einem ständigen Umbruch unterworfen ist und dass nach neuen Mitteln der Darstellung gesucht werden musste.
Betrachtet man seine ruhigen, stimmungsvollen Landschaften und die friedlichen idyllischen Gegebenheiten, so überkommt einen ein inniges Behagen ob so einfacher Natürlichkeit. Man begegnet in den Bildern ziehenden Wolken im Himmelsblau, weissen Alpengipfeln hinter dunklen Wäldern und freundlichem Wiesengrün. Belebt wird die Landschaft immer wieder mit heimatlich verbundenen Menschen bei ihrer Arbeit, mit Pferden, Rindern und andern Haustieren, die der Künstler so treffend und lebendig darzustellen versteht.
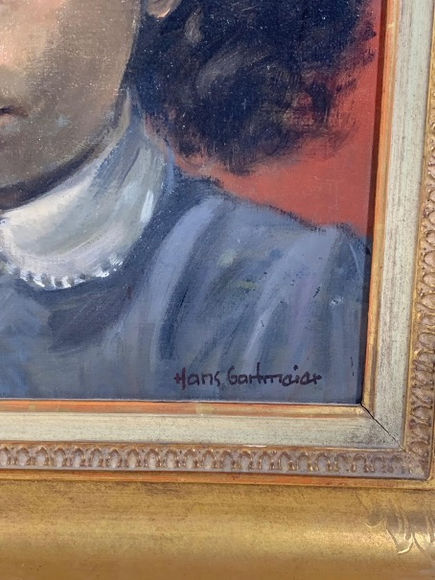
Hans Gartmeier (27.03.1910 - † 04.05.1986)
Signatur : unten Rechts
Technik: Öl auf Hartfaserplatte
Bild Mass : 29 x 36,5 cm
Masse mit Rahmen : 44 x 51 cm
Preis: CHF 420.-
Hans Gartmeier - künstlerisches Wirken
Hans Gartmeier, Kunstmaler aus dem Emmental. Hält in seinen Werken die Beziehung zum ursprünglichen Leben wach!
Sein künstlerisches Credo lautete: "Meine Gabe als Maler soll den Menschen zur Freude dienen. Im Sinne meiner Vorbilder. Ich versuche darzustellen, was die Natur schafft. Daneben will ich Charaktergestalten zeichnen, wie sie Jeremias Gotthelf beschrieben hat. Auf diese Art will ich ein Denkmal setzen, für die, die nach uns kommen."
Als Vorbilder haben Hans Gartmeier stets die flämischen Kleinmeister gedient. In seiner von grosser Sorgfalt gekennzeichneten Maltechnik finden wir den Ausdruck der Wirklichkeit.
Seine Kunst ist gradlinig und weicht nirgends von der realistischen Darstellung und der altmeisterlichen Gewissenhaftigkeit im Detail ab. Dabei wusste er, dass alle Kunst einem ständigen Umbruch unterworfen ist und dass nach neuen Mitteln der Darstellung gesucht werden musste.
Betrachtet man seine ruhigen, stimmungsvollen Landschaften und die friedlichen idyllischen Gegebenheiten, so überkommt einen ein inniges Behagen ob so einfacher Natürlichkeit. Man begegnet in den Bildern ziehenden Wolken im Himmelsblau, weissen Alpengipfeln hinter dunklen Wäldern und freundlichem Wiesengrün. Belebt wird die Landschaft immer wieder mit heimatlich verbundenen Menschen bei ihrer Arbeit, mit Pferden, Rindern und andern Haustieren, die der Künstler so treffend und lebendig darzustellen versteht.
Technik: Öl auf Hartfaserplatte
Bild Mass : 29 x 36,5 cm
Masse mit Rahmen : 44 x 51 cm
Preis: CHF 420.-
Hans Gartmeier - künstlerisches Wirken
Hans Gartmeier, Kunstmaler aus dem Emmental. Hält in seinen Werken die Beziehung zum ursprünglichen Leben wach!
Sein künstlerisches Credo lautete: "Meine Gabe als Maler soll den Menschen zur Freude dienen. Im Sinne meiner Vorbilder. Ich versuche darzustellen, was die Natur schafft. Daneben will ich Charaktergestalten zeichnen, wie sie Jeremias Gotthelf beschrieben hat. Auf diese Art will ich ein Denkmal setzen, für die, die nach uns kommen."
Als Vorbilder haben Hans Gartmeier stets die flämischen Kleinmeister gedient. In seiner von grosser Sorgfalt gekennzeichneten Maltechnik finden wir den Ausdruck der Wirklichkeit.
Seine Kunst ist gradlinig und weicht nirgends von der realistischen Darstellung und der altmeisterlichen Gewissenhaftigkeit im Detail ab. Dabei wusste er, dass alle Kunst einem ständigen Umbruch unterworfen ist und dass nach neuen Mitteln der Darstellung gesucht werden musste.
Betrachtet man seine ruhigen, stimmungsvollen Landschaften und die friedlichen idyllischen Gegebenheiten, so überkommt einen ein inniges Behagen ob so einfacher Natürlichkeit. Man begegnet in den Bildern ziehenden Wolken im Himmelsblau, weissen Alpengipfeln hinter dunklen Wäldern und freundlichem Wiesengrün. Belebt wird die Landschaft immer wieder mit heimatlich verbundenen Menschen bei ihrer Arbeit, mit Pferden, Rindern und andern Haustieren, die der Künstler so treffend und lebendig darzustellen versteht.

Hans Gartmeier (27.03.1910 - † 04.05.1986)

Alphonse REY (1865-1938)
Segelboot an der Küste im Abendlicht.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.

Alphonse REY (1865-1938)
Segelboot an der Küste im Abendlicht.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.

Alphonse REY (1865-1938)
Segelboot an der Küste im Abendlicht.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.

Alphonse REY (1865-1938)
Segelboot an der Küste im Abendlicht.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.
Aquarell auf Papier
Signatur: unten rechts
Originalrahmen
Blattmass: 32 x 48 cm
Preis: CHF 160.-
Biographie:
Maler, Aquarellist, Orientalist, Alphonse Rey war ein Schüler von Félix Ziem. Er malt hauptsächlich Aquarelle,inspiriert von der provenzalischen Landschaft, den Küsten des Mittelmeers oder seinen jährlichen Reisen nach Algerien. Er wurde außerdem zum Kurator des Ziem-Museums in Martigues ernannt.

Alphonse REY (1865-1938)

Lucien Clergue (1934-2014)
Serie Toros muertos, Silberabzug, ex 13, datiert 1960, Studiostempel auf der Rückseite, signiert auf der Rückseite, 50x60 cm
Série toros muertos, tirage argentique, ex 13, daté 1960, tampon de l'atelier au dos, signé au dos.
Masse: 50x60 cm
Preis Bild: CHF 530.-
Preis Rahmen: CHF 320.-
Leben:
Lucien Clergue (* 14. August 1934 in Arles; † 15. November 2014 in Nîmes)[1] war ein französischer Fotograf, Autor und Filmemacher. Er war bekannt für seine Objektfotografie und für weibliche Akte, und auch durch Picasso, der ihn als einer der ersten als Künstler anerkannte, während derlei Fotos (sofern auch das Gesicht der dargestellten Person erkannt werden konnte) in Frankreich damals als Pornografie galten und somit illegal waren.
Biographie:
Geboren wurde Lucien Clergue 1934 in Arles als Sohn kleiner Ladenbesitzer. Die Eltern ließen ihn von Kind an das Violinspiel erlernen. Lucien war begabt, allerdings fehlte den Eltern das Geld, um ihm ein Studium am Konservatorium zu ermöglichen. Lucien entdeckte jedoch die Fotografie für sich und schon sein frühes Werk zeigt ein ausgezeichnetes Verständnis des Mediums.
1953 lernte er Pablo Picasso bei einem Stierkampf kennen und zeigte ihm einige Bilder. Picasso ermutigte ihn, ihm weitere Fotografien zu senden. Lucien arbeitete ermutigt an mehreren Foto-Zyklen, unter anderem einem Zyklus über Zigeuner im Süden Frankreichs ("Saltimbanques"), der später dem Gitarristen Manitas de Plata auf dem Weg zur internationalen Bekanntschaft half. 1955 kam es zu einem zweiten persönlichen Treffen, bei dem sich Lucien Clergue und Pablo Picasso auch anfreundeten. Diese Freundschaft, die bis zum Tod Picassos bestehen blieb, wurde später von Clergue in dem Buch "Picasso mon ami" (Paris, 1993) dokumentiert. Clergue machte auch mehrere Porträt-Fotografien von Picasso.
1968 begründete er mit seinem Freund Michel Tournier das jährlich im Juli in Arles abgehaltene Fotografie-Festival Rencontres Internationales de la Photographie, das sich mittlerweile zu einer der größten und einflussreichsten Veranstaltungen in Europa entwickelt hat.
Sein Werk fand immer mehr Anerkennung. Aufträge von Magazinen und Illustrationen für Bücher, wie beispielsweise für die des Schriftstellers Yves Navarre folgten. 1979 erlangte er an der Universität der Provence in Marseille die Doktorwürde.
Clergue kämpfte erfolgreich für die Anerkennung der Fotografie als Kunst in Frankreich. Am 28. Mai 1965 eröffnete Lucien Clergue gemeinsam mit Jean-Maurice Rouquette die erste allein der Fotografie gewidmete Sektion im französischen Kunstmuseum in Arles, der viele bekannte Fotografen auf Grund der Freundschaft zu Clergue und Rouquette Werke spendeten.
Im Alter erfolgten auch zahlreiche Ehrungen für sein Lebenswerk. 2003 wurde Lucien Clergue Ritter der Légion d’honneur und 2006 als erster Fotograf Mitglied in der französischen Académie des Beaux-Arts, deren Präsident er für das Jahr 2013 wurde.
Lucien Clergue lebte und arbeitete in Arles.[2]
Wirken:
Themen seiner frühen Werke sind der weibliche Körper und der Stierkampf, später widmet er sich der Fragmentfotografie. Technisch wurde sein Werk sehr durch die neue Überblend- und die Polaroid-Technologie beeinflusst.
Lucien Clergue wurde sowohl von Pablo Picasso als auch von Jean Cocteau als Künstler hoch geschätzt. Picasso war schon in den 1950ern von der künstlerischen Begabung Clergues überzeugt. Er verglich die Bildkomposition und Herangehensweise mit jener der Maler Manet oder Renoir.
Série toros muertos, tirage argentique, ex 13, daté 1960, tampon de l'atelier au dos, signé au dos.
Masse: 50x60 cm
Preis Bild: CHF 530.-
Preis Rahmen: CHF 320.-
Leben:
Lucien Clergue (* 14. August 1934 in Arles; † 15. November 2014 in Nîmes)[1] war ein französischer Fotograf, Autor und Filmemacher. Er war bekannt für seine Objektfotografie und für weibliche Akte, und auch durch Picasso, der ihn als einer der ersten als Künstler anerkannte, während derlei Fotos (sofern auch das Gesicht der dargestellten Person erkannt werden konnte) in Frankreich damals als Pornografie galten und somit illegal waren.
Biographie:
Geboren wurde Lucien Clergue 1934 in Arles als Sohn kleiner Ladenbesitzer. Die Eltern ließen ihn von Kind an das Violinspiel erlernen. Lucien war begabt, allerdings fehlte den Eltern das Geld, um ihm ein Studium am Konservatorium zu ermöglichen. Lucien entdeckte jedoch die Fotografie für sich und schon sein frühes Werk zeigt ein ausgezeichnetes Verständnis des Mediums.
1953 lernte er Pablo Picasso bei einem Stierkampf kennen und zeigte ihm einige Bilder. Picasso ermutigte ihn, ihm weitere Fotografien zu senden. Lucien arbeitete ermutigt an mehreren Foto-Zyklen, unter anderem einem Zyklus über Zigeuner im Süden Frankreichs ("Saltimbanques"), der später dem Gitarristen Manitas de Plata auf dem Weg zur internationalen Bekanntschaft half. 1955 kam es zu einem zweiten persönlichen Treffen, bei dem sich Lucien Clergue und Pablo Picasso auch anfreundeten. Diese Freundschaft, die bis zum Tod Picassos bestehen blieb, wurde später von Clergue in dem Buch "Picasso mon ami" (Paris, 1993) dokumentiert. Clergue machte auch mehrere Porträt-Fotografien von Picasso.
1968 begründete er mit seinem Freund Michel Tournier das jährlich im Juli in Arles abgehaltene Fotografie-Festival Rencontres Internationales de la Photographie, das sich mittlerweile zu einer der größten und einflussreichsten Veranstaltungen in Europa entwickelt hat.
Sein Werk fand immer mehr Anerkennung. Aufträge von Magazinen und Illustrationen für Bücher, wie beispielsweise für die des Schriftstellers Yves Navarre folgten. 1979 erlangte er an der Universität der Provence in Marseille die Doktorwürde.
Clergue kämpfte erfolgreich für die Anerkennung der Fotografie als Kunst in Frankreich. Am 28. Mai 1965 eröffnete Lucien Clergue gemeinsam mit Jean-Maurice Rouquette die erste allein der Fotografie gewidmete Sektion im französischen Kunstmuseum in Arles, der viele bekannte Fotografen auf Grund der Freundschaft zu Clergue und Rouquette Werke spendeten.
Im Alter erfolgten auch zahlreiche Ehrungen für sein Lebenswerk. 2003 wurde Lucien Clergue Ritter der Légion d’honneur und 2006 als erster Fotograf Mitglied in der französischen Académie des Beaux-Arts, deren Präsident er für das Jahr 2013 wurde.
Lucien Clergue lebte und arbeitete in Arles.[2]
Wirken:
Themen seiner frühen Werke sind der weibliche Körper und der Stierkampf, später widmet er sich der Fragmentfotografie. Technisch wurde sein Werk sehr durch die neue Überblend- und die Polaroid-Technologie beeinflusst.
Lucien Clergue wurde sowohl von Pablo Picasso als auch von Jean Cocteau als Künstler hoch geschätzt. Picasso war schon in den 1950ern von der künstlerischen Begabung Clergues überzeugt. Er verglich die Bildkomposition und Herangehensweise mit jener der Maler Manet oder Renoir.

Lucien Clergue (1934-2014)
Serie Toros muertos, Silberabzug, ex 13, datiert 1960, Studiostempel auf der Rückseite, signiert auf der Rückseite, 50x60 cm
Série toros muertos, tirage argentique, ex 13, daté 1960, tampon de l'atelier au dos, signé au dos.
Masse: 50x60 cm
Preis Bild: CHF 530.-
Preis Rahmen: CHF 320.-
Leben:
Lucien Clergue (* 14. August 1934 in Arles; † 15. November 2014 in Nîmes)[1] war ein französischer Fotograf, Autor und Filmemacher. Er war bekannt für seine Objektfotografie und für weibliche Akte, und auch durch Picasso, der ihn als einer der ersten als Künstler anerkannte, während derlei Fotos (sofern auch das Gesicht der dargestellten Person erkannt werden konnte) in Frankreich damals als Pornografie galten und somit illegal waren.
Biographie:
Geboren wurde Lucien Clergue 1934 in Arles als Sohn kleiner Ladenbesitzer. Die Eltern ließen ihn von Kind an das Violinspiel erlernen. Lucien war begabt, allerdings fehlte den Eltern das Geld, um ihm ein Studium am Konservatorium zu ermöglichen. Lucien entdeckte jedoch die Fotografie für sich und schon sein frühes Werk zeigt ein ausgezeichnetes Verständnis des Mediums.
1953 lernte er Pablo Picasso bei einem Stierkampf kennen und zeigte ihm einige Bilder. Picasso ermutigte ihn, ihm weitere Fotografien zu senden. Lucien arbeitete ermutigt an mehreren Foto-Zyklen, unter anderem einem Zyklus über Zigeuner im Süden Frankreichs ("Saltimbanques"), der später dem Gitarristen Manitas de Plata auf dem Weg zur internationalen Bekanntschaft half. 1955 kam es zu einem zweiten persönlichen Treffen, bei dem sich Lucien Clergue und Pablo Picasso auch anfreundeten. Diese Freundschaft, die bis zum Tod Picassos bestehen blieb, wurde später von Clergue in dem Buch "Picasso mon ami" (Paris, 1993) dokumentiert. Clergue machte auch mehrere Porträt-Fotografien von Picasso.
1968 begründete er mit seinem Freund Michel Tournier das jährlich im Juli in Arles abgehaltene Fotografie-Festival Rencontres Internationales de la Photographie, das sich mittlerweile zu einer der größten und einflussreichsten Veranstaltungen in Europa entwickelt hat.
Sein Werk fand immer mehr Anerkennung. Aufträge von Magazinen und Illustrationen für Bücher, wie beispielsweise für die des Schriftstellers Yves Navarre folgten. 1979 erlangte er an der Universität der Provence in Marseille die Doktorwürde.
Clergue kämpfte erfolgreich für die Anerkennung der Fotografie als Kunst in Frankreich. Am 28. Mai 1965 eröffnete Lucien Clergue gemeinsam mit Jean-Maurice Rouquette die erste allein der Fotografie gewidmete Sektion im französischen Kunstmuseum in Arles, der viele bekannte Fotografen auf Grund der Freundschaft zu Clergue und Rouquette Werke spendeten.
Im Alter erfolgten auch zahlreiche Ehrungen für sein Lebenswerk. 2003 wurde Lucien Clergue Ritter der Légion d’honneur und 2006 als erster Fotograf Mitglied in der französischen Académie des Beaux-Arts, deren Präsident er für das Jahr 2013 wurde.
Lucien Clergue lebte und arbeitete in Arles.[2]
Wirken:
Themen seiner frühen Werke sind der weibliche Körper und der Stierkampf, später widmet er sich der Fragmentfotografie. Technisch wurde sein Werk sehr durch die neue Überblend- und die Polaroid-Technologie beeinflusst.
Lucien Clergue wurde sowohl von Pablo Picasso als auch von Jean Cocteau als Künstler hoch geschätzt. Picasso war schon in den 1950ern von der künstlerischen Begabung Clergues überzeugt. Er verglich die Bildkomposition und Herangehensweise mit jener der Maler Manet oder Renoir.
Série toros muertos, tirage argentique, ex 13, daté 1960, tampon de l'atelier au dos, signé au dos.
Masse: 50x60 cm
Preis Bild: CHF 530.-
Preis Rahmen: CHF 320.-
Leben:
Lucien Clergue (* 14. August 1934 in Arles; † 15. November 2014 in Nîmes)[1] war ein französischer Fotograf, Autor und Filmemacher. Er war bekannt für seine Objektfotografie und für weibliche Akte, und auch durch Picasso, der ihn als einer der ersten als Künstler anerkannte, während derlei Fotos (sofern auch das Gesicht der dargestellten Person erkannt werden konnte) in Frankreich damals als Pornografie galten und somit illegal waren.
Biographie:
Geboren wurde Lucien Clergue 1934 in Arles als Sohn kleiner Ladenbesitzer. Die Eltern ließen ihn von Kind an das Violinspiel erlernen. Lucien war begabt, allerdings fehlte den Eltern das Geld, um ihm ein Studium am Konservatorium zu ermöglichen. Lucien entdeckte jedoch die Fotografie für sich und schon sein frühes Werk zeigt ein ausgezeichnetes Verständnis des Mediums.
1953 lernte er Pablo Picasso bei einem Stierkampf kennen und zeigte ihm einige Bilder. Picasso ermutigte ihn, ihm weitere Fotografien zu senden. Lucien arbeitete ermutigt an mehreren Foto-Zyklen, unter anderem einem Zyklus über Zigeuner im Süden Frankreichs ("Saltimbanques"), der später dem Gitarristen Manitas de Plata auf dem Weg zur internationalen Bekanntschaft half. 1955 kam es zu einem zweiten persönlichen Treffen, bei dem sich Lucien Clergue und Pablo Picasso auch anfreundeten. Diese Freundschaft, die bis zum Tod Picassos bestehen blieb, wurde später von Clergue in dem Buch "Picasso mon ami" (Paris, 1993) dokumentiert. Clergue machte auch mehrere Porträt-Fotografien von Picasso.
1968 begründete er mit seinem Freund Michel Tournier das jährlich im Juli in Arles abgehaltene Fotografie-Festival Rencontres Internationales de la Photographie, das sich mittlerweile zu einer der größten und einflussreichsten Veranstaltungen in Europa entwickelt hat.
Sein Werk fand immer mehr Anerkennung. Aufträge von Magazinen und Illustrationen für Bücher, wie beispielsweise für die des Schriftstellers Yves Navarre folgten. 1979 erlangte er an der Universität der Provence in Marseille die Doktorwürde.
Clergue kämpfte erfolgreich für die Anerkennung der Fotografie als Kunst in Frankreich. Am 28. Mai 1965 eröffnete Lucien Clergue gemeinsam mit Jean-Maurice Rouquette die erste allein der Fotografie gewidmete Sektion im französischen Kunstmuseum in Arles, der viele bekannte Fotografen auf Grund der Freundschaft zu Clergue und Rouquette Werke spendeten.
Im Alter erfolgten auch zahlreiche Ehrungen für sein Lebenswerk. 2003 wurde Lucien Clergue Ritter der Légion d’honneur und 2006 als erster Fotograf Mitglied in der französischen Académie des Beaux-Arts, deren Präsident er für das Jahr 2013 wurde.
Lucien Clergue lebte und arbeitete in Arles.[2]
Wirken:
Themen seiner frühen Werke sind der weibliche Körper und der Stierkampf, später widmet er sich der Fragmentfotografie. Technisch wurde sein Werk sehr durch die neue Überblend- und die Polaroid-Technologie beeinflusst.
Lucien Clergue wurde sowohl von Pablo Picasso als auch von Jean Cocteau als Künstler hoch geschätzt. Picasso war schon in den 1950ern von der künstlerischen Begabung Clergues überzeugt. Er verglich die Bildkomposition und Herangehensweise mit jener der Maler Manet oder Renoir.

Eugen Zardetti (1849-1926)
Rechts unten signiert.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.

Eugen Zardetti (1849-1926)
Rechts unten signiert.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.

Eugen Zardetti (1849-1926)
Rechts unten signiert.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.
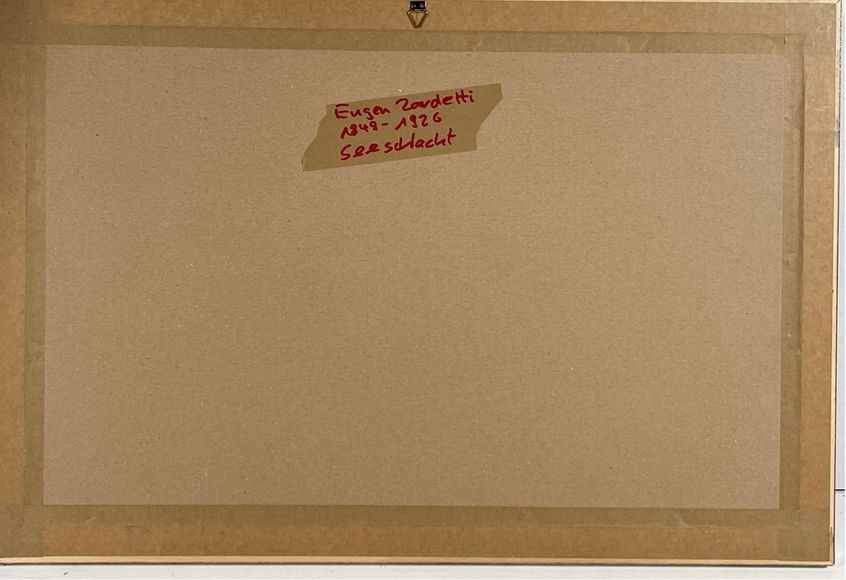
Eugen Zardetti (1849-1926)
Rechts unten signiert.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.
Rückseitig beschriftet und datiert.
Technik: Öl auf Karton
Masse mit Rahmen: 67 x 47 cm
Bildmasse: 61 x 39 cm
Preis: CHF 540.-
Biographie:
Eugen Zardetti (* 27. November 1849
in Rorschach; † 21. Februar 1926 in Luzern) war ein Schweizer Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier.
Eugen Zardetti studierte in Innsbruck, Genf, Luzern und Karlsruhe und war ab 1885 vor allem in Bregenz, wo er die Villa Mirador bewohnte, und ab 1914 in Luzern tätig.
Während seines Studiums in Innsbruck trat er 1866 der AV Austria Innsbruck im ÖCV bei.
Zardettis Interesse galt unter anderem der Technik. Er war der Besitzer des ersten industriell gefertigten Autos in Österreich, eines dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagens mit der Fahrgestellnummer 24, den er 1898 zu einem Vierradwagen umbauen ließ. Dieses Fahrzeug ging nach Zardettis Tod 1926 in den Besitz des Technischen Museums in Wien über, wo es sich immer noch befindet.
Bis 1896 war Zardetti der einzige Autobesitzer in Vorarlberg.
Im Jahr der Anschaffung seines Fahrzeugs, 1893, führte er ein Motorwagen-Tagebuch, das erhalten geblieben ist. Das Tagebuch wurde zusammen mit Gemälden Zardettis 2007 in einer Ausstellung in der Vorarlberger Landesbibliothek präsentiert.
Eugen Zardetti war auch jener Bregenzer Onkel der Schriftstellerin Lilly Braumann-Honsell, der sich die erste private Dampfyacht auf dem Bodensee leistete.
1885 wurde Zardettis Sohn Otto Eugen Zardetti geboren, der an der Stella Matutina ausgebildet wurde und dann ein Jurastudium in Zürich aufnahm.

Anton Huter (1905. Crikvenica – 1961. Beograd)
Öl auf Holzplatte
Bildmass: 370 x 450 mm
Masse mit Rahmen: 495 x 410 mm
Preis: CHF 240.-
Bildmass: 370 x 450 mm
Masse mit Rahmen: 495 x 410 mm
Preis: CHF 240.-

Anton Huter (1905. Crikvenica – 1961. Beograd)
Öl auf Holzplatte
Bildmass: 370 x 450 mm
Masse mit Rahmen: 495 x 410 mm
Preis: CHF 240.-
Bildmass: 370 x 450 mm
Masse mit Rahmen: 495 x 410 mm
Preis: CHF 240.-

Anton Huter (1905. Crikvenica – 1961. Beograd)
Biographie:
Seine Kindheit verbrachte er in Triest, Rijeka und Zemun, wo er bis zum Ende des Ersten Weltkriegs lebte. Nach Kriegsende zog er mit seiner Familie nach Belgrad und schrieb sich 1922 an der Kunstschule ein, die er 1927 abschloss (Professoren Milan Milovanović, Petar Dobrović und Ljuba Ivanovic). 1928 setzte er seine Studien im Atelier von Andrea Lot in Paris fort, als er zum ersten Mal in einer Gruppenausstellung mit anderen jugoslawischen Malern in Paris erschien. Ende 1928 stellte er auf der Ersten Herbstausstellung im Kunstpavillon "Cvijeta Zuzorić" in Belgrad aus, dann mit der Künstlergruppe Oblik, 1936 nahm er an der sogenannten Boykottausstellung der Gruppe Leben teil, und nach dem Krieg stellte er weiterhin mit derselben Gruppe aus, die ihren Namen in Independent änderte, sowie auf den Ausstellungen der ULUS-Mitglieder. 1947 arbeitete er kurzzeitig als Professor an der Schule für angewandte Kunst und ab 1948 als ordentlicher Professor an der Akademie für angewandte Kunst in Belgrad, wo er an der Abteilung für Grafik Zeichnen, Buchausstattung und Abendakt unterrichtete. Er beschäftigte sich mit Illustration und Bucheinrichtung. Er malte Landschaften, Stillleben, Akte, Porträts, Kompositionen sowie Miniaturen. Für seine Arbeit erhielt er mehrere renommierte Anerkennungen und Preise. 1935 wurde er mit dem Politika-Preis ausgezeichnet.
Das anfängliche Interesse an expressionistischen und kubistischen Formen im Werk Anton Huters näherte sich schließlich dem Intimismus und dem poetischen Realismus und wurde so zu einem der Grundzüge seines Werks. Die Kunst des Zeichnens, die sie bei den Professoren der Kunstschule in Belgrad, Ljubo Ivanović, Petar Dobrović und Milan Milovanović, erwarb, beeinflusste die Entstehung des charakteristischen künstlerischen Prozesses von Huter. Die geübte Beherrschung verschiedener Techniken (Kohle, Kreide, Tinte, Feder) gilt als eine Besonderheit von Huters schöpferischem Werk. Im Themenkreis des Autors nimmt neben Landschaften, Veduten und Porträts auch das Genre der Szenen einen besonderen Platz ein, die von sozialen Themen geprägt sind.
Mit dem Aufkommen der neuen Staatsideologie an der Macht ging auch ihre Verherrlichung einher. 1944 war Huter in der Propagandaabteilung des Obersten Hauptquartiers des Nationalen Befreiungskrieges tätig und konzentrierte sein Talent und seine Fähigkeiten in der angewandten Grafik auf die Gestaltung von Werken im Bereich des Grafikdesigns - Briefmarken, Einladungen, Grußkarten, Plakate und Illustrationen.
Lösungen für Illustrationen und Plakate fand er in der sorgfältigen Lektüre literarischer Vorlagen sowie in einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit der Situation und dem Zustand, den ein bestimmtes Werk darstellen sollte. Er verwebte seinen fröhlichen Geist mit der Illustration von Kinderbüchern wie Robizon Crusoe, Andersens Märchen, Herzen, Igelgeschichten, Events on the Menu, Cinderella, In Our Garden. Huter ist auch verantwortlich für die Geburt von Medvedić, das Logo des Verlags Dečja knjiga, sowie für das Erscheinen des grünen Schulheftes, an das sich viele Nachkriegsgenerationen erinnern. Ein wahres, vollständiges und bedeutungsvolles Bild des Schaffens des Künstlers auf allen Gebieten vermittelte am besten eine große posthume Retrospektive, die 1962 im Kunstpavillon "Cvijeta Zuzorić" stattfand, an dem Ort, an dem Huter zum ersten Mal ausstellte. Huter war "ein reiner und wahrhaftiger Maler und zugleich unabhängig. Er sah aus wie niemand anderes als er selbst."
Seine Kindheit verbrachte er in Triest, Rijeka und Zemun, wo er bis zum Ende des Ersten Weltkriegs lebte. Nach Kriegsende zog er mit seiner Familie nach Belgrad und schrieb sich 1922 an der Kunstschule ein, die er 1927 abschloss (Professoren Milan Milovanović, Petar Dobrović und Ljuba Ivanovic). 1928 setzte er seine Studien im Atelier von Andrea Lot in Paris fort, als er zum ersten Mal in einer Gruppenausstellung mit anderen jugoslawischen Malern in Paris erschien. Ende 1928 stellte er auf der Ersten Herbstausstellung im Kunstpavillon "Cvijeta Zuzorić" in Belgrad aus, dann mit der Künstlergruppe Oblik, 1936 nahm er an der sogenannten Boykottausstellung der Gruppe Leben teil, und nach dem Krieg stellte er weiterhin mit derselben Gruppe aus, die ihren Namen in Independent änderte, sowie auf den Ausstellungen der ULUS-Mitglieder. 1947 arbeitete er kurzzeitig als Professor an der Schule für angewandte Kunst und ab 1948 als ordentlicher Professor an der Akademie für angewandte Kunst in Belgrad, wo er an der Abteilung für Grafik Zeichnen, Buchausstattung und Abendakt unterrichtete. Er beschäftigte sich mit Illustration und Bucheinrichtung. Er malte Landschaften, Stillleben, Akte, Porträts, Kompositionen sowie Miniaturen. Für seine Arbeit erhielt er mehrere renommierte Anerkennungen und Preise. 1935 wurde er mit dem Politika-Preis ausgezeichnet.
Das anfängliche Interesse an expressionistischen und kubistischen Formen im Werk Anton Huters näherte sich schließlich dem Intimismus und dem poetischen Realismus und wurde so zu einem der Grundzüge seines Werks. Die Kunst des Zeichnens, die sie bei den Professoren der Kunstschule in Belgrad, Ljubo Ivanović, Petar Dobrović und Milan Milovanović, erwarb, beeinflusste die Entstehung des charakteristischen künstlerischen Prozesses von Huter. Die geübte Beherrschung verschiedener Techniken (Kohle, Kreide, Tinte, Feder) gilt als eine Besonderheit von Huters schöpferischem Werk. Im Themenkreis des Autors nimmt neben Landschaften, Veduten und Porträts auch das Genre der Szenen einen besonderen Platz ein, die von sozialen Themen geprägt sind.
Mit dem Aufkommen der neuen Staatsideologie an der Macht ging auch ihre Verherrlichung einher. 1944 war Huter in der Propagandaabteilung des Obersten Hauptquartiers des Nationalen Befreiungskrieges tätig und konzentrierte sein Talent und seine Fähigkeiten in der angewandten Grafik auf die Gestaltung von Werken im Bereich des Grafikdesigns - Briefmarken, Einladungen, Grußkarten, Plakate und Illustrationen.
Lösungen für Illustrationen und Plakate fand er in der sorgfältigen Lektüre literarischer Vorlagen sowie in einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit der Situation und dem Zustand, den ein bestimmtes Werk darstellen sollte. Er verwebte seinen fröhlichen Geist mit der Illustration von Kinderbüchern wie Robizon Crusoe, Andersens Märchen, Herzen, Igelgeschichten, Events on the Menu, Cinderella, In Our Garden. Huter ist auch verantwortlich für die Geburt von Medvedić, das Logo des Verlags Dečja knjiga, sowie für das Erscheinen des grünen Schulheftes, an das sich viele Nachkriegsgenerationen erinnern. Ein wahres, vollständiges und bedeutungsvolles Bild des Schaffens des Künstlers auf allen Gebieten vermittelte am besten eine große posthume Retrospektive, die 1962 im Kunstpavillon "Cvijeta Zuzorić" stattfand, an dem Ort, an dem Huter zum ersten Mal ausstellte. Huter war "ein reiner und wahrhaftiger Maler und zugleich unabhängig. Er sah aus wie niemand anderes als er selbst."
bottom of page
